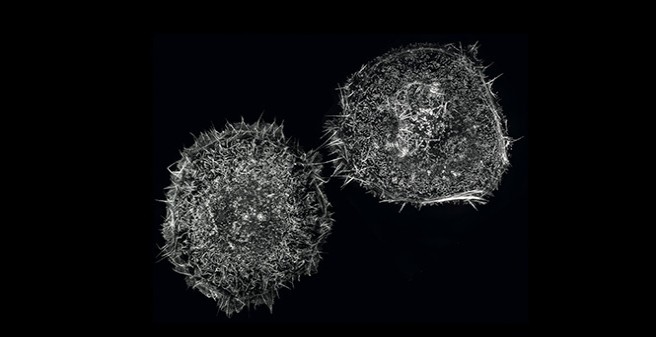Lab general
How do interactions of cells govern the function of an organism? What happens in disease, if crucial cell-cell interactions are dysfunctional? How can we better treat these diseases?
The three work groups of the Institute of Anatomy and Experimental Morphology investigate these and related important research questions.